




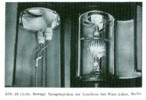






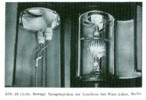

Im Rahmen der
nationalsozialistischen
Umgestaltung von Berlin in die „Reichshauptstadt
Germania“ fanden erste
wissenschaftliche Versuche zu einer verkehrstechnisch sicheren
Beleuchtung in
Straßentunneln statt. Heute erinnern nur noch wenige
Fragmente an die damalige
aufwändige Planung.[1] 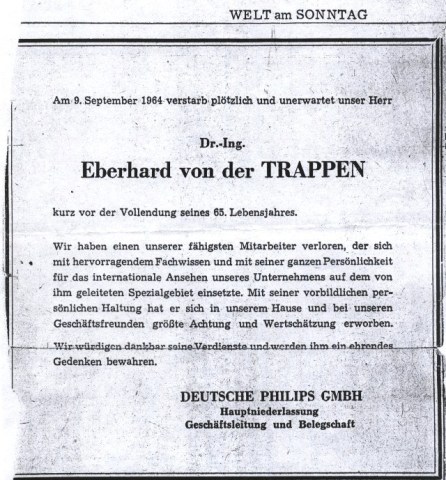
Am 16. September 1964 erschien in der „Welt am Sonntag“ eine Todesanzeige der Deutschen Phillips GmbH für den kurz zuvor verstorbenen Dr.-Ing. Eberhard von der Trappen, welcher „sich mit hervorragendem Fachwissen und mit seiner ganzen Persönlichkeit für das internationale Ansehen unseres Unternehmens auf dem von ihm geleiteten Spezialgebiet“ eingesetzt hatte.[2] In diesem Spezialgebiet, der Beleuchtung im Straßenverkehr, war von der Trappen fast 30 Jahren lang als führender Fachmann anerkanntermaßen tätig gewesen.
Von der
Trappen, 1899 in
Dortmund geboren, hatte in Hannover und Dresden Elektrotechnik
studiert. Nach
verschiedenen kurzen Beschäftigungsverhältnissen trat
er 1927 eine Stelle als
Betriebsingenieur bei der 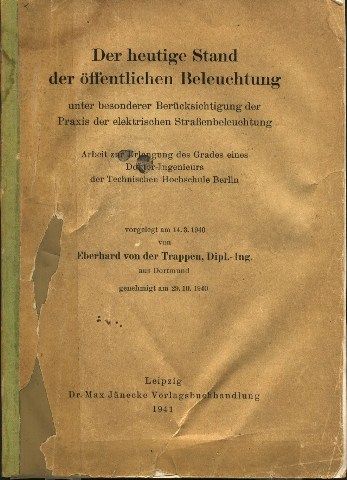 Berliner
Bewag (Berliner Kraft- und Licht-AG) an, wo
er schnell Karriere machte. Bereits nach einem halben Jahr
wurde er
Leiter
eines
Verkehrsbüros und übernahm ab 1930 die Leitung der
Abteilung Öffentliche Beleuchtung.[3]
1938 wurde er vom „Generalbauinspektor für die
Neugestaltung der
Reichshauptstadt“ (GBI), Albert Speer, zum
„Beauftragten für das
Beleuchtungswesen des GBI“ ernannt und somit
zuständig für alle
verkehrstechnischen Beleuchtungsfragen für Berlin und andere
Umgestaltungsstädte im Reich. In seinem ersten Vortrag als
Beleuchtungsbeauftragter bei einer Fachtagung der Deutschen
Lichttechnischen
Gesellschaft an der TH Berlin am 27.10.1938 äußerte
er sich zufrieden über die
neuen Einflußmöglichkeiten:[4]
Berliner
Bewag (Berliner Kraft- und Licht-AG) an, wo
er schnell Karriere machte. Bereits nach einem halben Jahr
wurde er
Leiter
eines
Verkehrsbüros und übernahm ab 1930 die Leitung der
Abteilung Öffentliche Beleuchtung.[3]
1938 wurde er vom „Generalbauinspektor für die
Neugestaltung der
Reichshauptstadt“ (GBI), Albert Speer, zum
„Beauftragten für das
Beleuchtungswesen des GBI“ ernannt und somit
zuständig für alle
verkehrstechnischen Beleuchtungsfragen für Berlin und andere
Umgestaltungsstädte im Reich. In seinem ersten Vortrag als
Beleuchtungsbeauftragter bei einer Fachtagung der Deutschen
Lichttechnischen
Gesellschaft an der TH Berlin am 27.10.1938 äußerte
er sich zufrieden über die
neuen Einflußmöglichkeiten:[4]
„Es
muß als
ein uns
Lichttechniker sehr erfreuendes Moment festgestellt werden,
daß sich die Baumeister
der neuen
Straßen Adolf Hitlers nicht mit einer schnellen
Lösung der
Beleuchtungsfrage begnügen und dann zu Anlagen kommen, die von
dem Althergebrachten
nicht sonderlich abweichen, sondern daß man sich so ausgiebig
mit den Problemen
der guten,
schönen und zweckmäßigen
Beleuchtung befaßt, daß die Lichttechniker
warme Köpfe bekommen.[…] Wir sind stolz
darauf zu wissen, daß der Führer selbst hier und da
trotz zweifellos
wichtigerer Dinge, die von ihm beurteilt werden müssen, noch
Zeit findet, sein
Urteil in lichttechnischen Dingen in die Waagschale zu werfen.
[…]“
guten,
schönen und zweckmäßigen
Beleuchtung befaßt, daß die Lichttechniker
warme Köpfe bekommen.[…] Wir sind stolz
darauf zu wissen, daß der Führer selbst hier und da
trotz zweifellos
wichtigerer Dinge, die von ihm beurteilt werden müssen, noch
Zeit findet, sein
Urteil in lichttechnischen Dingen in die Waagschale zu werfen.
[…]“
Die hier genannte
Achsenplanung war das Kernstück der
Umgestaltungspläne für Berlin in die
Reichshauptstadt
„Germania“. Der erste – und einfachere
Teil – war die
Fertigstellung der Ost-West-Achse (Kaiserdamm –
Straße des 17.
Juni – Unter den
Linden) im Jahre 1938 mit der Veränderung
des Straßenprofils,
der Versetzung
der Siegessäule
vom
Königsplatz vor dem Reichstag
auf den Großen Stern und die Errichtung von
über 1600 Straßenlaternen,
deren Entwurf von
Speer persönlich
stammte und die in ihrer
lichttechnischen Gestaltung durch von der Trappen ausgeführt
wurden. Der
zentrale Bereich der projektierten Nord-Süd-Achse sollte von
der „Halle des
Volkes“ nordwestlich des Reichstags über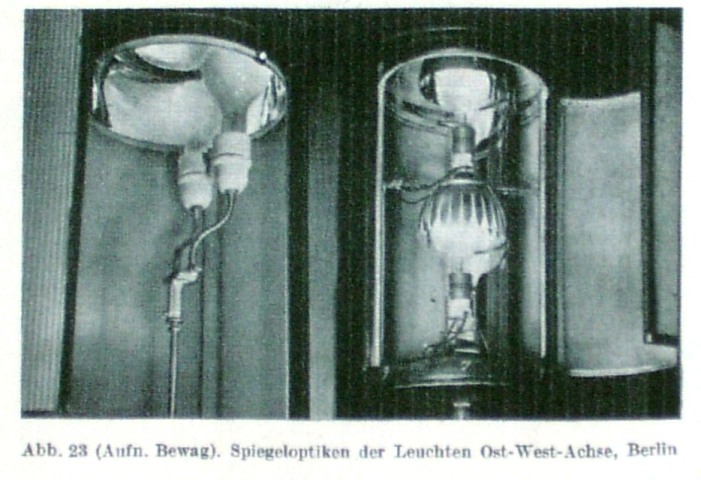 vier
Kilometer nach Süden durch den
Stadtkörper
geschlagen werden und seinen Abschluß in einem
Südbahnhof in Höhe
der heutigen Papestraße finden.[5]
vier
Kilometer nach Süden durch den
Stadtkörper
geschlagen werden und seinen Abschluß in einem
Südbahnhof in Höhe
der heutigen Papestraße finden.[5]
Da
für den Kreuzungsbereich
der beiden Prachtstraßen das Aufstellen von Ampeln als
unangemessen
empfunden wurde,
mußten die Planer des
GBI umfangreiche Straßentunnel planen. Dabei orientierten sie
sich in Breite
und Gefälle an vergleichbaren Bauwerken anderer
europäischer Länder, um diese
in Ausmaß, Gestaltung und Sicherheitsstandards in
den
Schatten zu stellen.[6]
Gleiches galt für die Beleuchtung der Tunnel, wie von der
Trappen in dem
bereits erwähnten Vortrag weiter ausführte:
„Zu der Beleuchtung der Ost-West-Achse und der geplanten Nord-Süd-Achse gehört auch die Beleuchtung der Verkehrstunnel, die eine Kreuzung des Verkehrs im Schnittpunkt der beiden Achsen ausschließen sollen.“[7]
Aus dieser
Planung
folgte eine mehrjährige Versuchs- und
Entwicklungstätigkeit. Als erste
Versuchsstrecke bot sich die neben der Berliner
Humboldt-Universität liegende
nördliche Rampe des Lindentunnels an,[8]
wo auf 100 Meter Länge mit verschiedenen Installationen die
Vorgaben für neu zu
entwickelnde Beleuchtungsgeräte festgelegt werden sollten. Von
der
Trappen
hatte zu diesem Zweck fünf Leitsätze formuliert:[9]
Die erste
Versuchsreihe,
bei der die Lichtmessung und technische Dokumentation in den
Händen von
Mitarbeitern der Firma Osram lag, fand – unbeeindruckt vom
beginnenden Zweiten
Weltkrieg – zwischen Oktober 1939 und
Februar 1940 statt. Die
Finanzierung der
Versuche war zu diesem Zeitpunkt keineswegs gesichert; es bestand
jedoch
Einigkeit, daß öffentliche Einrichtungen
für die Kosten heranzuziehen seien, um
keinen Interessenkonflikt durch die Beteiligung der Privatwirtschaft
entstehen
zu lassen.[10]
Da
bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Adaptionszeit des Auges
vorlagen, mußte diese
zunächst ermittelt werden; der
Wert lag bei 1 bis 2
Sekunden, was bei der
Geschwindigkeit von 60 km/h einer
Fahrtstrecke von ca. 70
Metern entsprach.[11]
Um Irritationen des Auges zu vermeiden, wurde eine
gleichmäßige Ausleuchtung
der Tunneldecke angestrebt; die Lichtstärke der Ein- und
Ausfahrten sollte an
das jeweilige Außenlicht angepaßt sein,
was eine
erhöhte Anforderungen an die
Regelbarkeit der Beleuchtungsstärke mit sich
brachte. Zusätzlich fiel die
erhebliche Belastung der Gehäuse durch den Winddruck der
passierenden Fahrzeuge
auf.[12]
Im Februar 1940
wurden
ausgewählte Ergebnisse der ersten Versuchsreihe mit Fotos
dokumentiert und eine
Präsentation für Albert
Speer vorbereitet.[13]
Anschließend erfolgte die Demontage und Verlegung der
Versuchsanordnung in den
östlichen der beiden Straßentunnelstutzen unter der
Ost- West-Achse, welche in
Höhe des heutigen Sowjetischen Ehrenmals als
Bauvorleistung erstellt worden waren, um ein
erneutes
„Aufreißen“ der
Straße beim Bau der Nord-Süd-Achse zu vermeiden.
Während der Lindentunnel nur
eine Fahrbahnbreite von sechs Metern zuließ, sollten die
geplanten
Straßentunnel tatsächlich bis zu 14,5 Meter breit
sein. Hier erhielten
verschiedene Firmen nun die Möglichkeit, ihre speziell nach
den festgelegten
Anforderungen entwickelte Beleuchtungsgeräte in realistischer
Größenordnung zu
testen; beteiligt waren die Siemens-Schuckert-Werke (SSW)
sowie die Firma
Hellux, die AEG-Beleuchtungskörper GmbH, sowie die
Firma Goerz
als Tochter der
Zeiss Ikon.
Zunächst
belegte die
AEG
die Versuchsstrecke, wobei deren mit Spiegeln bzw. Nitra-Lampen
ausgestatteten
Geräte nicht den
Vorstellungen von der Trappens entsprachen.[14]
Anschließend übernahmen
abwechselnd
Zeiss/Goerz, AEG
und SSW den Tunnel für
Versuche. AbHerbst 1941 blieben Leuchten der
SSW eingebaut, die zwar
in ihrer
Beleuchtungscharakteristik dem gewünschten Ergebnis sehr nah
kamen, jedoch die
für den mittleren Tunnelbereich
angestrebte Lichtstärke
von 40 Lux nicht erreichten.[15]
Dieses Manko sollte durch die Verdoppelung der
Leuchtenanzahl behoben
werden, was sich jedoch nicht
mehr realisieren
ließ.
Aus den
halbjährlichen
Berichten von der Trappens an den GBI gehen deutlich die
fortschreitenden
Schwierigkeiten durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft hervor. So
wurde
selbst die Anforderung zur Freigabe geringer Mengen an Material (363 kg
Eisen,
22,2 kg Kupfer, 0,9 kg Messing, 18 kg Aluminiumblech) im Oktober 1941
abgelehnt.[16]
Zuvor waren bereits kurzzeitig die Zugänge zum Versuchstunnel
zugemauert
worden; von der Trappen vermutete hinter dieser Aktion eine Anordnung
der
Gestapo.[17]
Weitere Versuche scheiterten nicht zuletzt am fortschreitenden
Fachkräftemangel
durch Einberufungen zum Kriegsdienst.
Zum 01.03.1943
ließ der
GBI sämtliche Arbeiten an Umgestaltungsplänen
einstellen, viele der beteiligten
Personen verloren ihren Status der
„UK-Stellung“ [unabkömmlich, d.Verf.],
und
in den Tunnel zog eine unterirdische Rüstungsproduktion ein.
Von der Trappen
trat als Ingenieur in die Organisation Todt ein,[18]
geriet zum Ende des Krieges in amerikanische Gefangenschaft
und arbeitete
anschließend bis zu seinem Tod 1964 bei der Firma Phillips
GmbH.
verloren ihren Status der
„UK-Stellung“ [unabkömmlich, d.Verf.],
und
in den Tunnel zog eine unterirdische Rüstungsproduktion ein.
Von der Trappen
trat als Ingenieur in die Organisation Todt ein,[18]
geriet zum Ende des Krieges in amerikanische Gefangenschaft
und arbeitete
anschließend bis zu seinem Tod 1964 bei der Firma Phillips
GmbH.
Die
Suchanfragen an die
Archive der beteiligten Firmen ergaben bislang kaum Hinweise auf die
damaligen Versuche.[19]
Sicherlich sind jedoch die gewonnenen Erkenntnisse durch die
überlebenden Fachleute
in die Entwicklung der Tunnelbeleuchtung nach
dem Zweiten
Weltkrieg
eingeflossen, so wie
auch von der Trappen seine
Fachkenntnis in weitere Tätigkeiten
einbringen konnte. Nach gravierenden Abrissen im
Bereich des Bebelplatzes und
des Maxim-Gorki-Theaters ist der Lindentunnel heute, wenn man
überhaupt noch davon
sprechen kann, nur
noch fragmentarisch vorhanden. In den Tunnelstümpfen unter der
Straße des 17.
Juni sind in der
Betonkonstruktion noch die vorbereiteten Aussparungen für die
Beleuchtung erkennbar. Lediglich zwei verrostete und verbogene Leuchten
im
östlichen Tunnelstutzen erinnert noch heute an die vor
über 65 Jahren erstmals
formulierten Ansprüche an
verkehrstechnisch sichere Tunnelbeleuchtung, die auch
heute nichts von ihrer
Aktualität verloren haben.[20]
Entwicklung der Tunnelbeleuchtung nach
dem Zweiten
Weltkrieg
eingeflossen, so wie
auch von der Trappen seine
Fachkenntnis in weitere Tätigkeiten
einbringen konnte. Nach gravierenden Abrissen im
Bereich des Bebelplatzes und
des Maxim-Gorki-Theaters ist der Lindentunnel heute, wenn man
überhaupt noch davon
sprechen kann, nur
noch fragmentarisch vorhanden. In den Tunnelstümpfen unter der
Straße des 17.
Juni sind in der
Betonkonstruktion noch die vorbereiteten Aussparungen für die
Beleuchtung erkennbar. Lediglich zwei verrostete und verbogene Leuchten
im
östlichen Tunnelstutzen erinnert noch heute an die vor
über 65 Jahren erstmals
formulierten Ansprüche an
verkehrstechnisch sichere Tunnelbeleuchtung, die auch
heute nichts von ihrer
Aktualität verloren haben.[20]